Es scheint, dass Ihr Warenkorb noch leer ist
Low-Code
Low-Code
Definition
Low-Code ist eine Methode der Softwareentwicklung, die auf grafischer Modelierung statt auf ausführlichem Handschriftencode basiert. Diese Plattformen ermöglichen es Entwicklern, Softwareanwendungen mit wenig bis gar keinem handgeschriebenen Code zu erstellen. Sie bieten ein hohes Maß an Abstraktion und Automatisierung bei der Entwicklung, um die Entwicklungseffizienz und Softwarequalität zu erhöhen.
Weitere Informationen (Wikipedia)
Funktionsprinzip
Low-Code-Plattformen arbeiten auf der Basis von Modellgetriebener Entwicklung. Entwickler nutzen vorgefertigte, wiederverwendbare Bausteine und konzentrieren sich eher auf die Modellierung der Anwendung anstatt auf das Schreiben individueller Codezeilen. Die Plattformen übersetzen dann diese Modelle automatisch in Code. Low-Code nutzt traditionell Drag-and-Drop-Schnittstellen und visuelle Modelle, um den Entwicklungsprozess weiter zu vereinfachen.
Praxisbeispiele
- Entwicklung von Kundenmanagementsystemen (CRM) in Unternehmen.
- Erstellung von mobilen Apps zur Steigerung von Kundeneinbindung und -zufriedenheit.
- Schnelle Prototypenerstellung für Softwareprodukte auf dem Marktplatz.
Vorteile
- Erhöhte Entwicklungs- und Einsatzgeschwindigkeit.
- Verbilligt die Kosten der Softwareentwicklung.
- Ermöglicht es Nicht-Entwicklern, einfache Anwendungen zu erstellen.
- Fördert Standardisierung und Konsistenz in der Anwendungsentwicklung.
- Vereinfacht die Anwendungspflege und -aktualisierung.
- Ermöglicht schnellere und effizientere Skalierung von Softwareanwendungen.
- Reduziert die Notwendigkeit detaillierter technischer Kenntnisse.
- Verbessert die Kommunikation zwischen Geschäfts- und IT-Bereichen durch visuelle Modelle.
Herausforderungen
- Mögliche Einschränkungen in den Anpassungsmöglichkeiten.
- Abhängigkeit von dem Low-Code-Plattformanbieter.
- Schwierigkeiten bei komplexen oder spezialisierten Anwendungen.
- Kann ineffizienten oder 'faulen' Code produzieren.
- Mögliche Sicherheitsprobleme durch die Verwendung von Standardkomponenten.
- Risiko der Codeverwässerung und Qualitätseinbußen.
- Nicht immer die beste Lösung für spezialisierte oder komplexe Softwareanforderungen.
- Mögliche Probleme mit der Skalierbarkeit oder Performance.
Best Practices
- Setzen von klaren Zielen und Erwartungen.
- Kompetenz- und Fähigkeitenentwicklung der Entwickler.
- Bewertung und Auswahl der richtigen Plattform.
- Verwendung für geeignete Projekte und Anwendungsfälle.
- Implementierung von Governance und Kontrollmechanismen.
- Kontinuierliches Testen und Überprüfen der Qualität.
- Sicherstellung der Integration mit bestehenden Systemen.
- Planung und Budgetierung der regelmäßigen Wartung und Aktualisierung.
Fazit
Low-Code bietet viele Vorteile und Potenziale, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklungs- und Bereitstellungsgeschwindigkeit sowie die Kostenersparnisse. Es hat auch das Potenzial, die Lücke zwischen IT- und Geschäftsbenutzer zu schließen und kann geschäftliche Anwender in die Softwareentwicklung einbeziehen. Low-Code ist nicht die Lösung für alle Entwicklungsprobleme und es gibt Herausforderungen und Einschränkungen, die berücksichtigt werden müssen. Trotzdem kann es eine sehr nützliche Ergänzung des Werkzeugkastens eines Softwareentwicklers sein.

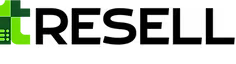
0 Kommentare